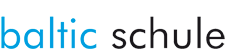Der 2. Weltkrieg ist seit über 75 Jahren vorüber, doch die Erinnerungen an die Zeit sind durchaus noch lebendig. Sie werden in vielen Familien erzählt oder sind in Berichten, Briefen oder Tagebüchern notiert. Manche schlummern im Verborgenen. Durch die jüngsten Ereignisse in der Ukraine sind diese Erinnerungen unvorhergesehen von aktueller Bedeutung.
Die 13c hat im Schuljahr 2020/21 recherchiert und, wo es ging, Zeitzeugen und deren Nachkommen befragt und ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Es sind einige Geschichten zusammengekommen, manche schön, manche traurig, auch schrecklich; einige sind aber auch voller Hoffnung und sogar lustig.
Auf jeden Fall sind es Erinnerungen, die geteilt werden sollten. Wir haben sie in unserem „Gedächtnisarchiv“ gesammelt.


Von Veilchen und Pferden
Wenn man heutzutage alte Menschen ansieht, dann fragt man sich nicht, wie ihre Kindheit war oder welche Erinnerungen und Erfahrungen diese Leute besitzen. Ich erzähle deshalb jetzt eine Geschichte von einem Menschen, der mir sehr am Herzen gelegen hat und es immer noch tut – meiner Großtante, die leider vor zwei Jahren verstorben ist. Bis vor wenigen Wochen, bevor ich ein von ihr selbst verfasstes Buch über ihre Kindheitsjahre während des Krieges gelesen habe, habe ich nicht gewusst, was sie in ihrem Leben alles erlebt hat.
Eine von vielen Geschichten aus ihrem Buch ist eine Erzählung aus dem Jahre 1945, als sie dreizehn Jahre alt gewesen ist. Es war ein Vorfrühlingstag in der Rhön nah bei Kassel, wo sie aufgewachsen ist. Sie beschreibt ihn als „strahlend schön“. Sie und ihre Freundin sind an diesem Sonntag auf die Suche nach Veilchen für ein Sträußchen gegangen. Beide laufen glücklich durchs Dorf und schauen an dem einen bestimmten Ort nach den Veilchen, wo sie immer zuerst zu finden sind. Sie finden sie genau dort in einer Hecke und pflücken ein paar Blüten und drapieren Blättchen drumherum, damit es ein richtiger kleiner Strauß wird.
Unterhalb der Hecke, auf einer Straße, die zum nächsten Dort führt, kommen plötzlich zwei Panjewagen (Gefährte mit Pferden vorne angespannt) und dahinter zwei Motorräder aus dem nahegelegenen Wald. Damals wissen weder sie oder ihre Freundin, was genau da aus den Bäumen gefahren kommt. Im gleichen Moment schießt ein kleines Flugzeug mit Glaskuppel wie aus dem Nichts hervor mit zwei Männern, die im Innenraum sitzen. Es fliegt tief, sehr tief. Die Mädchen werfen sich unter die Hecken und dann kommt „eine Salve von Schüssen nach der anderen“. Ein Soldat kullert den Abhang hinunter, der andere bleibt auf dem Bauch liegen. „Die Pferde fangen an entsetzlich laut zu schreien, ein Ton, den ich nie vergessen werde.“
Der Tiefflieger, der soeben die Soldaten und Pferde erschossen hat, macht einen Schwenk und ist weg. Fluchtartig rappeln sich die beiden Mädchen auf und laufen so schnell ihre wackeligen Beine sie tragen können nach Hause. In den Händen beider Mädchen hat sich das einst so schöne Veilchensträußchen zu einem Matschklößchen verwandelt.
Am selben Abend kommt eine Flüchtlingsfamilie schwer beladen mit riesigen Mengen Pferdefleisch in großen blutigen Betttüchern vorbei, welches für diese ein wahrer Feiertagsbraten gewesen ist.
Eine Geschichte aus der Zeit des Weltkrieges, wiedergegeben von Kaja Reutershan, der Großnichte der Zeitzeugin
Erinnerungen an die Kriegszeit
„Es wurde versucht, alles, was mit der aktuellen Kriegssituation zu tun hatte, von uns Kindern so gut wie möglich fernzuhalten. Wenn wir fragten, wurde uns nur eine knappe Antwort gegeben, manchmal bekamen wir auch gar keine.
Wir spielten draußen im Garten, als ein Kampfjet ganz dicht über das Dorf flog.
Ich wohnte mit meiner Familie in Lütjensee. Wir wohnten in einem ganz tollen Haus, direkt am See. Wir wohnten zu fünft in diesem Haus – meine Eltern, meine ältere Schwester, mein jüngerer Bruder und ich.
In Lütjensee lag das Dorf auf der einen Seite des Sees und auf der anderen Seite standen nur zwei Häuser. Zum einen das Haus, in welchem wir wohnten und zum anderen das der Sergels. Meine Eltern und die Sergels waren gut befreundet.
Ich besuchte zu der Zeit die Schule. Ich ging in die 4. Klasse, also musste ich ungefähr 9 Jahre alt gewesen sein.
Zum Schulalltag gehörte auch die Arbeit auf dem Feld. Meine Klasse wurde zum Ernten eingeteilt. Uns wurde ein bestimmter Teil des Feldes zugeteilt, wie wir später noch sahen.
Wir liefen gemeinsam von der Schule aus zu dem vier bis fünf Kilometer entfernten Feld.
Als wir uns dem Feld näherten, sahen wir, dass ein Teil in dem Feld abgesperrt war. Von weiter weg erkannte ich nicht direkt, was da abgesperrt war. Aber desto näher wir kamen, desto klarer wurde es mir – es war ein abgestürzter Jet.
Es war der Jet, der eine Woche zuvor haarscharf über das Dorf geflogen war.
Ich hatte ein ganz mulmiges Gefühl bei dem Anblick.
Auf dem ausgebrannten Wrack des Jets war noch das große Maschinengewehr, das bei der Bergung der Leiche und der Waffen offensichtlich nicht mitgenommen worden war.
Ein paar Wochen später, als Lübeck in der Nacht des 28. März 1942 zerbombt wurde, war die Luft morgens auch in Lütjensee verschmutzt und verdreckt.
Da ich noch sehr jung war, war das alles zwar real, und ich bekam es auch alles mit, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen, wusste nichts damit anzufangen.
Mein Vater, Alwin Blaue, war vom Beruf her Kriegsmaler. Jahre später hielt er Lübeck in seinem zerstörten Zustand auf Papier mit Stift und Pinsel fest. Erst durch die Bilder, die mein Vater mit der Zeit malte, bekam ich die Ausmaße der Zerstörung von Lübeck und Hamburg mit.
Einige der Werke sind heute noch in meinem Besitz.“
Sebastian Blaue, aufgeschrieben von seiner Enkelin Emilia Blaue

Sonntag, 20. 10. 2020
Ein Nachmittag mit einem Zeitzeugen
Heute ist Opas 81. Geburtstag und zum Kaffee & Kuchen trifft sich die Familie bei Oma und Opa zu Hause. Wenn ich meine Großeltern besuche, sprechen wir öfter mal von vergangenen Zeiten, wie es damals war oder was die beiden so erlebt haben. Als wir im Kunstunterricht die Aufgabe bekommen haben, Zeitzeugen nach ihren Erinnerungen zu befragen, kam mir deswegen direkt Opa in den Sinn.
Mein Opa ist 1939 geboren, im gleichen Jahr, in dem der 2. Weltkrieg ausgebrochen ist. Deswegen hat er nicht sehr viele bewusste Erinnerungen an den Krieg, aber er ist ein Zeitzeuge und deswegen wollte ich ihn unbedingt fragen, ob er mir hilft.
Normalerweise redet er sehr gerne und erzählt viele Witze, darüber müssen wir dann alle lachen. Aber heute ist er ungewöhnlich still und wirkt nicht ganz anwesend, ich merke, dass ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob ich ihn um Hilfe bitten möchte. Aber Oma kann ich nicht fragen, denn die ist erst am Ende des Kriegs geboren und kann sich nicht mal wirklich an die Zeit nach dem Krieg erinnern.
Wenn ich ein wenig an die geschichtlichen Ereignisse denke, die sich in Omas und Opas Kindheit so abgespielt haben, wird mir etwas mulmig, denn ich mag mir gar nicht ausmalen, wie es war, in dieser Zeit aufzuwachsen. Ich erinnere mich daran, dass es am 29. März 1942 einen Luftangriff gab, bei dem in der Nacht auf Palmsonntag mehrere hundert Tonnen Bomben auf Lübeck abgeworfen wurden. Zu dem Zeitpunkt war Opa etwas über zwei Jahre alt. Es erscheint es mir so paradox, dass Opa so etwas miterlebt hat und dennoch heute hier mit seiner Familie am Tisch sitzt, als Ehemann, als Vater von drei Kindern, als Großvater von acht Enkelkindern. Plötzlich wirkt alles, was wir in Geschichte gelernt haben, erschreckend nah und mir fällt jetzt erst auf, wie alt Opa eigentlich schon ist.
Als ich mich endlich durchringen kann, Opa um Hilfe zu bitten und die Aufgabe erkläre, wird es schlagartig ruhiger am Tisch. Schnell ergänze ich, dass es keine traurige Erinnerung sein muss, sondern vielleicht auch eine lustige Anekdote oder eine besondere Erinnerung, etwas Hoffnungsvolles. Opa erzählt dann schlussendlich aber nicht von sich selbst, sondern von meinem Uropa, der hat von 1902-1987 gelebt hat und mir wird bewusst, dass Opa mit einem Vater aufwuchs, der zwei Weltkriege überlebt hat. Meine Großeltern erzählen mir etwas über unsere Familiengeschichte und Oma zeigt mir alte Fotos, auch welche von ihrem Bruder, der im Krieg gedient hat. Aus einem alten Schrank holt sie außerdem unser Stammbuch, in dem ich später mit meiner Mutter gemeinsam herumblättere. Ich habe viele „Familienerbstücke“ noch nie gesehen und finde es deswegen umso interessanter, mir alles genau anzuschauen, mehr über meinen eigenen Ursprung zu erfahren.
Später erzählt Opa noch weiter, mein Uropa hätte wohl viel gearbeitet und kleine Miniatur-Schiffchen gebastelt, ich mache ein paar Fotos von einem aus der Vitrine im Flur und Oma erzählt, dass mein Uropa Schmuck für die Silberschmiede “Oehlschlaeger“ in Lübeck hergestellt hat, die gibt es sogar heute noch. Das klingt alles sehr interessant, aber ich bin mit den Erzählungen noch nicht ganz zufrieden, weil ich nicht so recht weiß, was ich für mein Kunstprojekt aufschreiben soll, aber als ich das Gespräch in eine andere Richtung lenken möchte, merke ich, dass es da zwar mehr zu erzählen gibt, aber das ich nicht weiter nachfragen sollte.
Als ich etwas später auf dem Heimweg bin und über den Nachmittag nachdenke, stelle ich fest, dass ich eigentlich ziemlich viel erfahren habe, nämlich, dass die Erzählungen und Erinnerungen in vielen unterschiedlichen Formen existieren und es nicht wichtig ist, eine konkrete Geschichte zu hören, sondern wertzuschätzen, dass man überhaupt mit seinen Großeltern sprechen kann.
Ich bin mit einem bestimmten Verständnis von der damaligen Zeit aufgewachsen, geprägt von Geschichtsunterricht, Literatur und Besuchen in Museen, natürlich auch von den Medien. Zu wissen, dass ich einen Menschen kenne, der ein Zeitzeuge ist, der viel Wissen in sich trägt, ist ein wahrer “Schatzfund“, es ist eigentlich für den Moment nicht von Bedeutung, ob ich alles weiß, was mein Opa weiß, viel wertvoller ist es, dass ich ihn kenne und dass er eine Art lebendiger Beweis dafür ist, wie die Zeit damals war.
Leia Schink

Asters Geschichte
„Nun saß ich da, eng an eng, rechts von meiner Mutter und links von meiner Schwester. Gegenüber von mir saßen fremde Leute, welche ich hier noch nie gesehen hatte, aber dennoch klammerten sie sich fast genau so fest an die Decke wie ich. Die Decke, die uns nicht wärmte, sondern mein kleines Geheimnis versteckt hielt. Ich zitterte, nicht vor Kälte, sondern vor Aufregung, und noch viel mehr vor Angst. Ich wollte sie nicht verlieren. Ich konnte sie nicht verlieren. Deshalb griff ich noch stärker in die Decke. Die mir gegenübersitzende Frau lächelte mich ermutigend an, aber trotzdem konnte ich erkennen, dass sie genauso nervös war wie ich. Was auch kein Wunder war, denn die Rufe und Schreie, das Heulen, Winseln und Jammern wurde immer lauter und lauter. Ich hielt meine rechte Hand unter die Decke, um sicherzugehen, dass sie noch da war, und flüsterte leise, dass sie ruhig bleiben soll. Ich betete, dass sie sich nicht bewegt oder gar einen Laut von sich gibt.
Die schweren Stiefel der Soldaten, welche die Zugabteilungen kontrollierten, rückten immer näher. Die Türen wurden nacheinander aufgerissen und weiteres Jammern war zu hören. So langsam füllte sich der Bahnsteig mit Zurückgelassenen, mit Trauer und etlichen Hunden. Hunde, die sich in den Boden kauerten und hilflos nach ihren Besitzern schrien. Sie war nur ein Bellen, ein Wimmern, ein zu tiefes Atmen entfernt, selber auf diesem Bahnsteig zu landen. Unsere Abteilungstür wurde aufgerissen und ein riesiger Soldat überflog unsere Gesichter. Er blieb an meinem Gesicht hängen und bemerkte zufrieden, wie ich mich an die Decke krallte und es nicht mal wagte, in seine Augen zu schauen. Für ihn war es Genugtuung, zu sehen, wie wir uns vor ihm fürchteten. Er fühlte sich respektiert und rief mit einem Nicken zu seinem Kollegen, dass alles in Ordnung sei. Ich spürte an meinem Bein, wie sie sich durch die laute Stimme erschreckte und mit ihren Hundepfoten in den Boden krallte. Auch die Frau gegenüber bekam es mit und fing sofort an zu husten. Sie hörte gar nicht mehr auf. Der Soldat schenkte ihr einen letzten kontrollierenden Blick und schloss die Abteilungstür so ruckartig, wie er sie geöffnet hatte. Kaum war sie geschlossen, atmete ich tief durch und fing unweigerlich an zu lachen. Wir hatten es geschafft, ich hatte es geschafft, Aster hatte es geschafft.“
Als mein Opa ungefähr 10 Jahre alt war, also in etwa 1945, lebte er mit seinen Eltern und seinen Geschwistern in Krakau. Damals bekam er als kleiner Junge von einem Bekannten der Eltern einen Welpen geschenkt. Dieser Welpe wurde für viele Jahre die treue Begleiterin meines Opas. Sie hatten es zu der damaligen Zeit nicht einfach, da der Alltag durch Hunger und Armut bestimmt war. Eine besonders schwierige Herausforderung war die Flucht vor den Russen zurück nach Lübeck.
Jana Post
Die Weihnacht der Nachkriegszeit
Meine Oma wurde am 26. Oktober 1933 geboren, sie war eins von acht Kindern. Ihr Vater war ein Bäckermeister und ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt.
Die Weihnachtszeit war die schönste Zeit des Jahres für meine Oma. Der See fror zu, der alte Holzschlitten konnte aus dem Schuppen geholt werden und es wurden warme Mützen und Handschuhe gestrickt, die ihre Geschwister und sie warmhielten.
Zur Weihnachtszeit wurde viel musiziert. Weihnachtslieder wurden auf einfachen Instrumenten wie der Blockflöte und der Mundharmonika angestimmt, diese unterstützten zusätzlich den Gesang. Omas Lieblingsweihnachtslied war „Stille Nacht“; immer wenn dieses Lied spielte, bekam meine Oma Tränen der Rührung.
Dann gab es die Weihnachtstraditionen. Als erstes musste ein Weihnachtsbaum her, aber die waren damals zu teuer für so eine einfache, große Familie. Meine Oma erzählte, wie ihre Familie sich nachts auf den Friedhof schlich und heimlich eine der Tannen abholzte. Diese wurde dann den ganzen Weg bis nach Hause getragen. Für den Weihnachtsbaum gab es natürlich einen traditionellen Schmuck. Zuerst selbstgebackene Lebkuchen, dann Mandarinen, das gebügelte, silberne Lametta, Kerzen, Walnüsse. Und der Stern durfte keinesfalls fehlen!
Das Weihnachtsfest wurde in der guten Stube abgehalten, welche bis Heiligabend von niemandem außer den Eltern betreten werden durfte, so war der Brauch. Als Geschenke strickten sich die Geschwister gegenseitig Kleidungsstücke, bastelten einfache Puppen und schnitzten kleine Figuren.
Wenn endlich Heiligabend anbrach, musste man sich fleißig waschen, zog dann die Sonntagskleider an und machte sich gegenseitig die Haare schön.
Nun folgte, zum Abend hin, der Gang zur Kirche. Wenn die Messe vorbei war, gingen meine Oma und ihre Familie beschwingt nach Hause. Das Essen wartete, es gab Würstchen und Kartoffelsalat.
Sobald das Mahl verspeist wurde und alle satt und glücklich waren, mussten noch Gedichte aufgesagt werden, bevor die Bescherung begann.
Die Familie meiner Oma hatte nicht viel, aber immer genug, sodass alle glücklich waren. Meine Oma erzählte oft von ihrer Kindheit und sprach nie von den unschönen Dingen, die ihrer Familie in der Nachkriegszeit widerfahren sind. Sie hatten mehr Glück als die meisten Familien. Meine Oma behielt sich diese Lebensfreude bis zum Schluss und hat sie an mich weitergegeben. Ich werde diese Lebensfreude in meinem Herzen tragen und sie an die Welt weitergeben.
Charlotte Eisenbeiß-Krickhuhn